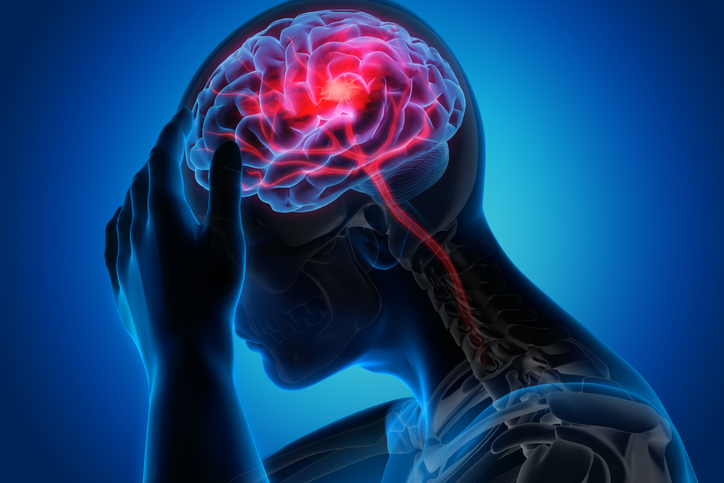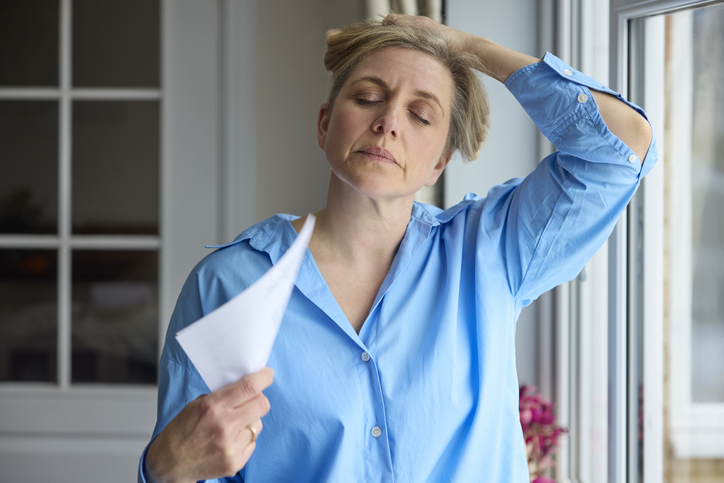Eine ebenso steile wie unbewiesene Meinung, als Fachwissen deklariert, geistert schon längere Zeit durch die „sozialen Medien“ und durch entsprechend empfängliche Elternkreise: Fluorid mache dumm, lautet diese Meinung. Vielleicht kann die aktuelle Langzeitstudie einer US-Wissenschaftlergruppe hier etwas Bewegung in die Debatte bringen? Anlass war die Frage, ob Trinkwasser fluoridiert werden solle oder nicht. Unabhängig von der Frage, wie man grundsätzlich zu einer „Behandlung“ von Trinkwasser steht, geht es darum, dass der natürliche Fluoridgehalt im Trinkwasser in den verschiedenen Regionen der USA und der Welt sehr unterschiedlich ausgeprägt ist. Und dass andere Studien zeigen, dass Kinder und Erwachsene in Regionen mit eher etwas höherem Anteil an natürlichem Fluorid die mit Abstand gesünderen Zähne haben. Was die Wissenschaftlergruppe von den bisherigen „Studien“ zum Thema hält, hat sie mit „nicht repräsentativ, nicht vergleichbar, nicht relevant“ ziemlich klar gemacht –zumal die untersuchten Kinder-Gruppen in eher sehr armen, ländlichen Bevölkerungsgruppen in Mexiko, China oder Indien lebten. Die aktuelle Studie basiert auf Daten von über 58.000 US-Jugendlichen aus 1980, über 25.000 wurden in den Folgejahren mehrfach befragt, die meisten Teilnehmer waren im Abschlussbefragungsjahr 2020 schon über 60 Jahre alt. Das Ergebnis in Kurzform: Junge Menschen, die mit empfohlenen Fluorid-Mengen im Trinkwasser groß wurden, hatten deutlich bessere kognitive Fähigkeiten im Wortschatz- und Lese-Vermögen sowie in mathematischen Fähigkeiten. Bilanz der Forscher: „Die Ergebnisse zeigen, dass die Trinkwasserfluoridierung Vorteile für die kognitive Entwicklung von Jugendlichen hat und schlimmstenfalls nicht schädlich fürs weitere Leben ist.“
Zucker: Verzicht für gesundes Altersherz
Nicht nur die Zahn- und Mundgesundheit profitiert lebenslang, wenn schon seit der frühen Kindheit der Zuckerkonsum deutlich reduziert wird: Offenbar schützt dieses Verhalten auch das Herz. So wie sich die Mundgesundheit mit den Lebensjahren auf der Grundlage dessen weiterentwickelt, was ihr aus den Kinderjahren mit auf den Weg gegeben wurde, geht auch die Herzgesundheit mit den Jahren in eine gesunde oder ungesunde Richtung. Chinesische Wissenschaftler haben kürzlich fast 64.000 Daten der britischen „Biobank“ zu der Fragestellung verglichen, welche Rolle reduzierter Zuckerkonsum auf die Entwicklung der Herzgesundheit im höheren Alter spielt. Das Durchschnittsalter der an der Studie beteiligten Probanden lag bei 55 Jahren. Es zeigte sich: Die Älteren, die in ihrer Kindheit nur wenig Zucker bekamen, hatten ein um 20 Prozent geringeres Risiko für spätere Herz-Kreislauf-Erkrankungen, um 25 Prozent niedriger lag das Risiko für einen Herzinfarkt, auch für tödliche Infarkte, ebenso das Risiko für Herzrhythmusstörungen und Herzinsuffizienz. Sogar um 31 % lag das Schlaganfallrisiko bei „Zuckerarmen“ niedriger als bei der Vergleichsgruppe. Hauptgründe dafür sind bessere Blutzucker- und Blutdruckwerte. Und noch etwas zeigte sich: Je länger man den Zuckerverbrauch reduzierte, desto besser war das Ergebnis. Das eindeutig erscheinende Ergebnis solle nun quer getestet werden mit Blick auf Genetik und Lebensstilfaktoren, um solche Effekte in ihrer Relevanz mit einzubeziehen. Auch die Einbeziehung der Ergebnisse mit Blick auf die Mundgesundheitsentwicklung wären interessant.
Hirnerkrankungen: Ist Parodontitis beteiligt?
Zu den Körperbereichen, deren krankhafte Entwicklung mit Parodontitis in Verbindung stehen könnten, gehört auch das Gehirn. Anhand von Daten einer Langzeit-Studie mit fast 16.000 Teilnehmern aus verschiedenen Gebieten in den USA hat eine interdisziplinäre US-Wissenschaftlergruppe nach entsprechenden Zusammenhängen geforscht. Ihre Fragestellung: Kann die Behandlung einer bestehenden Zahnbettinfektion die Entwicklung von Erkrankungen im Gehirn verhindern? Im Vergleich von Patienten mit und ohne Parodontitis zeigten diejenigen mit Zahnbettinfektion deutlich mehr Anzeichen für Entzündungen, Durchblutungsstörungen und Abbauprozesse von Gehirnbereichen. Und obwohl die Parodontitis keine direkte Rolle bei Erkrankungen der kleinen Hirngefäße (zerebrale Mikroangiopathie) spielt, ist es doch ihr systemischer Effekt: Im Fall einer Zahnbettentzündungen gelangen Entzündungskeime über die Blutbahn in den gesamten Körper – und auch durch die Bluthirnschranke in das Gehirn. Wenn die kleinen Blutgefäße im Gehirn infiziert werden, entwickelt sich eine Verdickung, Verengung und Verhärtung der Gefäßwände, dadurch kann sich eine Demenz entwickeln. Eine Wiederherstellung der Mundgesundheit durch eine Parodontitis-Therapie sorgt daher auch für eine Vorbeugung von Gehirn-Gefäßerkrankungen.
Wechseljahre: Effekte im Mund
Kürzlich hat ein Fachjournal rund um das Thema „Gesundheit in der Lebensmitte“ eine Vielzahl an Studien zu Menopause und Mundgesundheit ausgewertet und eine Ergebnisbilanz gezogen. Dabei zeigte sich, kurz gesagt, ein sehr deutlicher Zusammenhang von Knochenabbau im Kiefer, Parodontitis und beispielsweise Mundtrockenheit mit den Veränderungen im Hormonstatus der untersuchten Frauen. Während es eine Vielzahl an wissenschaftlichen Arbeiten zu Schlafstörungen, Hitzewallungen und anderen typischen Menopausen-Zuständen gibt, waren Untersuchungen zur Mundgesundheit eher rar. Die Ergebnisse zeigen, dass das Thema eine größere Aufmerksamkeit benötigt. Der Rückgang bestimmter Hormone im weiblichen Wechseljahre-Körper hat deutliche Folgen für die Schleimhäute, für die Zähne, für das Zahnbett und den Kieferknochen. Die Widerstandskraft gegen Infektionen wie Parodontitis sinkt durch eine geänderte Immunabwehr, das Zahnfleisch blutet leichter, das Zahnbett bildet sich vielleicht spürbar zurück und es droht Zahnverlust, auch weil durch den sinkenden Östrogenspiegel der Kieferknochen abgebaut wird. Eine frühere Studie an der Universität Greifswald hatte zudem gezeigt, dass Frauen, die den Hormonmangel nicht durch entsprechende Medikamente ausgleichen, deutlich mehr Zahnverlust hatten als die Vergleichsgruppe mit Hormonersatztherapie. Die Wissenschaftler begrüßen Angebote in der Zahnarztpraxis, die Frauen speziell in und nach den Wechseljahren begleiten und die Zahn- und Mundgesundheit erhalten helfen.
Neujahrsvorhaben: „Dentalscham“ beenden
Rund um den Jahreswechsel nehmen sich viele Menschen einiges vor, was im neuen Jahr besser oder schöner werden soll. Wie viele Menschen es hierzulande genau sind, denen wir die Empfehlung „Dentalscham beenden“ mit auf deren Agenda 2026 geben möchten, weiß man nicht. Weit verbreitet sei dieses Phänomen „Dentalscham“, sagt eine internationale Wissenschaftlergruppe aus Dänemark und Großbritannien. Das Thema sei wenig erforscht – was recht unverständlich erscheint, wenn man bedenkt, welche Auswirkungen diese besondere Variante von Angst vor dem Zahnarztbesuch hat. Soziale Ungleichheit ist nur ein Aspekt. Wer Angst davor hat, seine Zähne zu zeigen, die von mangelhafter Mundhygiene erzählen, von zuviel Rauchen und/oder Alkohol, von zuviel ungesunder Ernährung und viel zu vielen Belastungen im Leben, die von Selbstfürsorge abhalten, der gerät nur immer weiter in diese fatale Richtung. Dabei haben Zahnärzte das alles schon gesehen, mehrfach, manches mal auch noch schlimmer als im eigenen Fall. Wenn das Praxisteam gut geschult ist, erspart es sich auch jedwede Kritik am Lebensstil, sondern hilft beim ersten Schritt, dessen Folgen zu überwinden. Das Praxisteam kann mit viel Erfahrung und Ermutigung dabei helfen, den Mund und die Zähne wieder in einen gesunden Zustand zu bringen. Der Aufwand lohnt sich, denn ein kranker Mund führt zu einem vielfältig kranken Körper und belastet die Seele. Der Jahresanfang 2026 wäre doch ein sehr guter Zeitpunkt, die Abwärts-Spirale zu stoppen.
Party-Lachgas: Erfrierungen
Erfreulicherweise scheint der Trend, eine Party durch Lachgas-Nutzung aufzupeppen, zumindest hierzulande schon wieder abzuebben: Vielleicht haben ja die vielen überzeugenden Berichte mit dazu beigetragen, die auf die schädlichen Folgen des missbräuchlichen Nutzens verweisen. Was dabei selten berichtet wird: Lachgas kann im Mund und im Rachen zu Erfrierungen führen. Die Schleimhaut ist gerötet, geschwollen, oft auch verletzt, mitbetroffen sind oft die Gaumenzäpfchen und auch die Stimmbänder. Die Verletzungen sind erheblich schmerzhaft und die Heiserkeit beim Sprechen belastend. Rettungskräfte berichten darüber hinaus über notärztliche Einsätze nach Lachgas-Nutzung und auch Todesfälle, besonders bei Festivals. Da das manchmal auch aromatisierte Gas mancherorts leicht verfügbar ist, wird es von Unkundigen als harmlos eingeschätzt. Ärzte, die mit Party-Lachgas-Folgen bei Patienten zu tun haben, beobachten zudem in der Folge Störungen im Vitamin-B12-Haushalt des Körpers sowie im Nervensystem. In Deutschland ist derzeit ein Gesetzentwurf auf dem Weg, der die risikoreichen Missbrauchs-Folgen stoppen will durch Einschränkungen beim Vertrieb, durch Verbot von Erwerb und Besitz bei Minderjährigen. Im Vorfeld gibt es bereits erste Bundesländer, die den Verkauf von Lachgas an Jugendliche schon jetzt unter Strafe stellen.
Backenzähne: Schutz durch Versiegelung
In der Zeit des Durchbruchs der bleibenden Zähne ist die Kieferentwicklung noch nicht abgeschlossen – der Kieferknochen wächst noch, ebenso wie das umgebende Gewebe. Ob er wächst wie gewünscht oder sich ungünstig verformt, hängt auch von der Gesundheit und natürlichen Entwicklung der Zahnreihe ab: Ist sie intakt und stehen alle Zähne am vorgesehenen Platz, hat der Knochen eine „Leitplanke“, an der er seine Entwicklung orientiert. Zu den diesbezüglich wichtigsten Zähnen gehören die „Backenzähne“ (Molaren). Ihre mit „Bergen und Tälern“ versehene Kaufläche, die auf den gegenüberliegenden Zahn abgestimmt ist und zum gemeinsamen Zermalmen der Nahrung dient, ist leider auch für Bakterien attraktiv: Die unebene Oberfläche bietet Raum für Zahnbelag und, besonders bei erhöhtem Kariesrisiko des Kindes, auch für bakterielle Besiedlung. Es ist deshalb eher nicht verwunderlich, dass viele Kinder ihre ersten Karieslöcher auf den Kauflächen ihrer Molaren erleben. Diesem Prozess kann man allerdings entgegenwirken: Bei Karies-Risiko-Kindern können die unebenen Kauflächen versiegelt werden: Nach vielfältigen Vorbereitungsschritten, die auch dazu dienen, bestehende Schäden zu reparieren, wird ein spezieller Dental-Kunststoff aufgetragen. Je nach Produkt härtet er von selbst aus oder unter Zuhilfenahme einer speziellen Lampe. Die Versiegelung selbst ist ein „Klassiker“ in der Zahnheilkunde – immer mal wieder prüfen aber die wissenschaftlichen Fachgesellschaften sowohl die Voraussetzungen als auch die zur Verfügung stehenden Materialien bis hin zu Aufgaben im Bereich der Nachsorge, um das Vorgehen bei Versiegelungen auf den aktuellen wissenschaftlichen Stand zu bringen. Die entsprechende Leitlinie ist gerade wieder aktualisiert worden, dabei wurden auch neue Materialien berücksichtigt.
Vorzeitiger Zahnverlust: Erberkrankung?
In den Zahnarztpraxen hören die Behandlungsteams immer mal wieder von Patienten, sie hätten ihre schlechten Zähne geerbt. Fast immer ist aber eher eine lückenhafte Zahnpflege „ererbt“, heißt es dann oft als Antwort es zahnmedizinischen Teams. Versteckter Zahnstein untermauert meist diese Einschätzung. Dennoch gibt es Erberkrankungen, zu deren Folgen auch Zahnschäden gehören können, wie eine große Zahnärztezeitung gerade berichtete. Beispielhaft sei das sogenannt Papillon-Lefèvre-Syndrom genannt, das auf einer Genmutation beruht. Die Betroffenen leiden unter einer Art Verhornungsstörung, sie entwickeln vor allem unnatürlich verdickte Handinnenflächen und Fußsohlen. Schon im Kleinkindalter leiden sie unter entzündlichen Zahnbetterkrankungen aufgrund tiefer Zahnfleischtaschen, in denen schädliche Bakterien fast ungestört Gewebe zersetzen können, weil auch die Immunabwehr des Körpers reduziert ist. Zudem wird Kieferknochen abgebaut. Werden die Kinder nicht sachgerecht behandelt, unter anderem mit besonders intensiver Mundhygiene und gezielt eingesetzter Antibiotika, sind sie zahnlos, wenn ihre Grundschulzeit beginnt. Solche und weitere Erberkrankungen benötigen häufig die interdisziplinäre Unterstützung über die Zahnmedizin hinaus – und viel Geduld, bis die Kiefer fertig entwickelt sind und Zahnersatz eingesetzt werden kann.
Karies: vorbeugen mit Kamille?
Karies kommt nicht direkt von Zuckerkonsum: Nur wenn Mundbakterien vor Ort sind, in diesem Fall an den Zähnen, wo die Keime Halt finden im Zahnbelag, und wenn sie dann Zucker aufnehmen und Säuren ausscheiden – nur dann entsteht Karies. Es sind die Stoffwechselprodukte der zuckerliebenden Bakterien, die den Zahnschmelz auflösen und dadurch zu Löchern führen. Damit das nicht passiert, wird seit vielen Jahren Fluorid eingesetzt: Es schafft eine schützende Verbindung mit dem Zahnschmelz und verhindert Säureschäden. Ob das noch besser geht? Das fragten sich brasilianische Forscher und testeten verschiedene Stoffe, die aus der Kariesverhütung bekannt waren und auf unterschiedliche Weise in die Kariesentwicklung eingreifen: Fluorid, Chlorhexidin – und für die Kontrollgruppe eine im ph-Wert stabile Pufferlösung. Neu dabei: echte Kamille in Form von entsprechendem Extrakt. Fünf Gruppen wurden getestet: eine nur mit Fluorid, eine nur mit Kamillenextrakt, eine mit Kamille und Fluorid, eine mit Chlorhexidin und die dem Vergleich dienende Gruppe mit der „Pufferlösung“. Das Ergebnis: Kombiniert man Fluorid mit Kamille, findet sich die mit Abstand stärkste Reduzierung der für die Kariesentwicklung wichtigsten Bakteriengruppen Streptococcus mutans und einer Lactobacillus-Art. Zudem blieb der Zahnschmelz stabiler als in allen Vergleichsgruppen. Auch wenn Fluorid allein besser abschnitt als Kamillenextrakt allein, ist das Gesamtergebnis bei Kombination signifikant stärker. Auch die Schutzschicht auf dem Zahn war bei der Kombination am besten entwickelt. Nun bleibt abzuwarten, wann entsprechende Kombipräparate für den Einsatz am Patienten geprüft und bei gutem Ergebnis freigegeben werden.
Jugendliche: Zahn-Attraktivität
Während noch immer Menschen, die viel in der Öffentlichkeit stehen, besonders weiße Zähne bevorzugen, lässt der Trend zu Weiß – zumindest bei den Jugendlichen – inzwischen nach. Eine schwedische Studie zeigt, dass derzeit nicht etwa weiße Zähne zum Schönheitsideal gehören, sondern dass alle in der gleichen Zahn-Farbe sind. Insbesondere Füllungsflecken oder Schmelzschäden, aber auch Verfärbungen anderer Art stehen auf der Kritikliste ganz oben. Die Ergebnisse der Online-Umfrage unter jungen Erwachsenen basieren auf einer Beurteilung von auf Fotos vorgelegten Zahn-Situationen. Auch die eigenen Zähne bewerteten die rund 2000 teilnehmenden jungen Menschen. Dabei waren drei Viertel aller Teilnehmer zufrieden mit der Farbe ihres eigenen Gebisses – solange keine Unregelmäßigkeiten in der Färbung erkennbar waren. Gab es solche Auffälligkeiten, hatten rund 10 % bereits Korrekturen vornehmen lassen, jeder Zweite junge Erwachsene mit optischen Disharmonien hat sich vorgenommen, diese eventuell beseitigen zu lassen. Die Wissenschaftler weisen auf die Rolle solcher optischen Belastungen und das Folge-Verhalten der jungen Menschen hin: Wer mit seinen Zähnen nicht zufrieden ist, neigt dazu, weniger zu lächeln, sich gehemmt hinsichtlich des Zeigens der Zähne zu verhalten und sich weniger attraktiv zu fühlen. Das Studienergebnis zeigt, welche große Rolle als schön empfundenen Zähne für die persönliche Entwicklung spielen. Für die zahnärztliche Versorgung eventueller Zahnschäden bedeutet das, dass die Füllung möglichst zahnfarben, im Farbton der anderen Zähne, und eher „unsichtbar“ sein sollte.