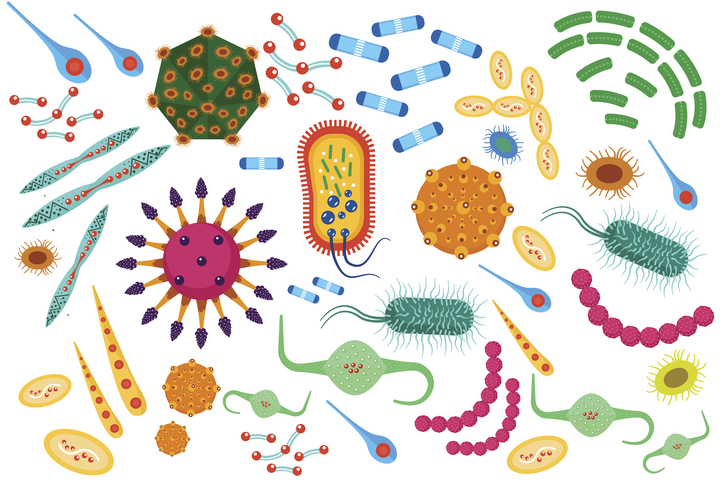Bluthochdruck (Hypertonie) ist ein Hauptrisiko für Herzinfarkt, Schlaganfall und weitere schwerwiegende Erkrankungen und Gesundheitsstörungen. Insofern gilt es, die Hypertonie in den Griff zu bekommen und beispielsweise medikamentös zu senken. Das ist möglich, wenn Patienten zum Arzt gehen und diese den Bluthochdruck festgestellt und ein Behandlungsprogramm entwickelt haben. Das wiederum setzt voraus, dass Menschen auch zum Arzt gehen, zumal, wenn sie sich nicht akut erkrankt fühlen. Der britische Nationale Gesundheitsdienst (NHS) geht deshalb jetzt einen neuen Weg: Er führte kürzlich Blutdruck-Tests in der Zahnarztpraxis ein. Grund dafür ist die Einschätzung, dass über vier Millionen Briten eine unentdeckte Hypertonie aufweisen. Um diese leichter erkennen und behandeln zu können, hat der NHS Bluthochdruck-Tests bei Zahnärzten in ersten ausgewählten Regionen Groß-Britanniens eingeführt. Dahinter steht die Erwartung, dass Patienten mit Zahnschmerzen eher eine Zahnarztpraxis aufsuchen als eine Arztpraxis des NHS, da sie keine behandlungsbedürftigen Symptome spüren. In einem ersten Testlauf hat sich gezeigt, dass jeder zehnte Patient in einer Zahnarztpraxis unter bisher nicht entdeckter Hypertonie litt. Die Diagnostik beim Zahnarzt wird als bequem und unkompliziert bezeichnet und soll dazu dienen, diese lebenswichtige Kontrolle mehr Menschen als bisher zu ermöglichen.
Sinusitis: Folgen auch für Implantate
Wer schon einmal eine Sinusitis, eine Nasennebenhöhlenentzündung hatte, kennt den Effekt: Sie drückt auf die Kiefer, manchmal hat man auch Zahnschmerzen. Das verwundert wenig, denn die großen Nasennebenhöhlen liegen gleich über dem Seitenzahnbereich im Oberkiefer. Ist die Nebenhöhle entzündet und geschwollen, drückt dies auf das Kiefergewebe. Auch andersherum gibt es Verbindungen: Ist die Zahnwurzel im Oberkiefer entzündet oder hat sich um den Zahnwurzelbereich eine Infektion entwickelt, kann diese zu einer Belastung bis hin zu einer Entzündung der Nasennebenhöhle führen. Es ist also gut nachvollziehbar, dass immer öfter Zahnärzte, Kieferchirurgen und Hals-Nasen-Ohren-Ärzte (HNO-Ärzte) zusammenarbeiten. Auch im Falle nicht stabil stehender Zahn-Implantate kann eine Sinusitis ursächlich sein – insbesondere dann, wenn sie chronisch geworden ist. Wissenschaftler empfehlen daher Patienten mit häufiger oder chronischer Nasennebenhöhlenentzündung vor einer Implantatbehandlung eine entsprechende Untersuchung auch bei einem HNO-Arzt machen zu lassen. Sollte es einen Behandlungsbedarf geben, beispielsweise auch eine Operation zur besseren Belüftung der Nebenhöhlen, sollte dies möglichst vor Implantation umgesetzt werden. Insbesondere wenn ein Sinuslift geplant ist für die Implantatverankerung, also eine „Erweiterung“ des Kieferknochens in den Bereich der Nasennebenhöhle für mehr Halt und Stabilität, sollte die gesundheitliche Situation der Nebenhöhle vorab geprüft werden. Um im komplexen Bereich der Nebenhöhlen notwendige Erkenntnisse zu relevanten Struktur-Details und möglichen Infektionen zu gewinnen, sind nicht selten aufwändige bildgebende diagnostische Verfahren notwendig. Bei guter Zusammenarbeit im Bereich Zahnmedizin und Hals-Nasen-Ohrenheilkunde und aufeinander abgestimmten Abläufen ist dann das Einbringen eines Implantates auch unter Mitnutzung eines kleinen Teils der Nasennebenhöhle möglich.
Kinder-Karies: Bakterienfamilien wirken unterschiedlich
Im Mund herrscht reges Leben: Rund 700 unterschiedliche Bakterienfamilien leben in einer natürlichen Gemeinschaft und unterstützen oder bekämpfen sich gegenseitig. Die entsprechenden Folgen haben Auswirkungen auf die Mundgesundheit. So lange diese vielen Bakterienstämme in einem Gleichgewicht bleiben, geht es dem Mund gut: Nützliche und schädliche Bakterien bilden das Mikrobiom im Mund und sorgen dafür, dass Zähne und Zahnfleisch durch die verschiedenen Herausforderungen wie Nahrung und andere Stoffe keinen Schaden nehmen. Wächst eine schädliche Bakterienfamilie aber übermäßig, gerät das sensible System aus der Ordnung und es kommt beispielsweise zu Infektionen am Weichgewebe und Zerstörungen an der Zahnhartsubstanz. Da der Sockel für eine gesunde Zahn- und Mundentwicklung in der frühen Kindheit gelegt wird und das Mikrobiom dabei eine Rolle spielt, hat sich eine schwedische Wissenschaftlergruppe kürzlich dem Thema Keimstatus bei Kleinkindern angenommen: Wie verändert es sich durch Stillen, Ernährung, Medikamente und andere Einflussfaktoren? Ihre Studie zeigt, dass Kleinkinder aufgrund unterschiedlicher Situationen – beispielsweise auch infolge einer Antibiotika-Behandlung der werdenden Mutter – eine sehr verschiedene Zusammensetzung des Mikrobioms aufweisen. Je nach entdecktem Übergewicht mancher Bakterienarten neigten einige Kinder deutlich mehr zu frühkindlicher Karies, andere waren besser geschützt. Um Kleinkinder gut über diese sensible Phase der Zahn- und Mundentwicklung zu bringen, empfehlen die Wissenschaftler eine sorgfältige Mundpflege, die Bakterienstämme ins Gleichgewicht bringt: Die Studie zeigte, dass dies bei zweimal Zähneputzen täglich in den ersten Lebensjahren gut gelingen kann und sich das Kariesrisiko bei den Kindern damit um 70 Prozent senken lässt.
Schwangerschaft: Was verändert sich im Mund?
Wenn im Körper der werdenden Mutter ein Kind heranwächst, stellt sich der ganze Organismus darauf ein und bereitet dem kleinen Menschen ein gedeihliches Umfeld. Dabei spielen die Hormone eine erheblich gestaltende Rolle. Während manche Veränderungen des Körpers der werdenden Mutter auf den ersten Blick ersichtlich sind, bleiben andere im Verborgenen. Zu diesen gehören auch die Veränderungen im Mund. Am bekanntesten ist die sogenannte Schwangerschaftsgingivitis. In einem aktuellen Beitrag zur Zusammenarbeit von Gynäkologen und Zahnärzten berichtet eine große dentale Fachzeitschrift, dass fast jede werdende Mutter, wenn auch unterschiedlich intensiv, mit Zahnfleischproblemen zu tun hat. Es schwillt an, ist empfindlicher als sonst und blutet schneller. Die hormonelle Umstellung führt zu einer Erhöhung der Durchblutung der Gefäße und macht die Gefäßwände durchlässiger – so braucht es nur wenig Reiz von außen, damit Blut heraustritt. Zudem kann es aufgrund des angeschwollenen Gewebes zu mehr Zahntaschen kommen, in denen sich belastende Keime aus den Zahnbelägen (Plaque) ansammeln und das Gewebe zerstören. Da reicht dann oft auch eine sehr kleine Menge an Plaque, um zu Entzündungen und Blutungen zu führen. Manche wissenschaftlichen Studien sprechen auch von umgekehrten Zusammenhängen: Nicht nur kann eine Schwangerschaft zu unerwünschten Veränderungen im Mund führen – die Infektions-Belastung und Keime aus dem Mundraum können sich möglicherweise auch belastend auf die Schwangerschaft auswirken. Das aber ist nach wie vor nicht fundiert wissenschaftlich bestätigt. Um besser und fundierter für die Schwangeren da zu sein und sie bei einer gesunden Schwangerschaft zu unterstützen, haben die Bundeszahnärztekammer und der Berufsverband der Frauenärzte jetzt eine gemeinsame Zusammenarbeit gestartet.
Aus Fehlern lernen: Kongress zu wichtigem Thema
Ende November findet ein Fachkongress in Dresden statt, der ein sehr wichtiges Thema in den Fokus stellt: aus Fehlern lernen. „Lerngeschenke“ nennt der Veranstalter, die wissenschaftliche Deutsche Gesellschaft für Implantologie (DGI), seine Tagung, die damit nicht nur für die implantologischen Praxen spannend und wichtig ist, sondern für den gesamten Bereich Zahnmedizin in Wissenschaft und Praxis. Da die Jahrestagung der DGI zu den größten dentalen Fach-Kongressen in Europa gehört, ist dafür gesorgt, dass das Umlernen in den Zahnarztpraxen und in den Dentallaboren neuen Auftrieb erhält. Ziel ist, entstandene Fehler zu nutzen und damit Wiederholungen zu vermeiden. Auch bei den erfahrensten Kollegen seien Fehler nicht gänzlich vermeidbar, so die DGI-Kongresspräsidenten. Das Spektrum an Behandlungsverfahren habe sich in vergleichsweiser kurzer Zeit erheblich erweitert – das biete viele Chancen, Patienten noch individueller zu behandeln, aber dadurch auch grundsätzlich das Risiko, ein individuelles Detail zu übersehen. Insofern sei es wichtig, von den Fehlern anderer Kolleginnen und Kollegen zu lernen, um eben diese Fehler nicht selbst machen zu müssen. Zudem wird bei dem Kongress das Thema „Lerngeschenke“ nicht nur in Vorträgen und Fachdiskussionen übermittelt, sondern auch in Live-OPs. Fortbildung und damit Förderung der Behandlungsqualität ist eine Schwerpunktaufgabe der wissenschaftlichen Gesellschaften in Deutschland, unter denen die DGI die größte Fachgesellschaft ist. Die enorm hohe Zahl der Teilnehmer an den vielfältigen Fachkongressen alljährlich in Deutschland sichert und fördert das aktuelle Wissen und praktische Können und untermauert daher den hohen Qualitätsstandard der Zahnmedizin in unserem Land.
Bild: iStock/ Andrii Yalanskyi
TikTok-Trend: Zungenschaber
Aus den unterschiedlichen sozialen Medien gelangen immer wieder Trends in den Alltag der Menschen – bei TikTok insbesondere in den Alltag von Jugendlichen. Das sind nicht selten ungesunde Empfehlungen, die sich ausbreiten, manchmal aber gibt es auch Erstaunliches, was, wie in diesem Beispiel, einen gewissen gesunden Nutzen bringt: der Einsatz von Zungenschabern. Diese Mundhygiene-Hilfsmittel dienen dazu, Beläge auf der Zunge zu entfernen oder zu reduzieren, eine große Vielfalt an entsprechenden Schabern ist hierzulande im Handel verfügbar. Mit dem Zungen-Putzen werden bakterielle Beläge entfernt, die an Karies, an Zahnfleisch- und Zahnbett-Erkrankungen und nicht zuletzt an Mundgeruch beteiligt sein können. Millionenfach werden in den sozialen Medien Videos geklickt, die die Anwendung von Zungenschabern demonstrieren. Ziel der Filmchen ist die Botschaft, dass man mit regelmäßiger Zungenreinigung Mundgeruch verhindern kann. Für zahnärztliche Wissenschaftler ist die Thematik nicht neu – auch aus der Zahnmedizin gibt es vielfältige Empfehlungen, bei der Mundhygiene auch die Zungenreinigung mit zu berücksichtigen. Aber es gibt auch warnende Kritik: Wenn der Schaber nicht richtig angewendet wird, ist der Effekt zu gering – und wenn zu stark gekratzt wird, kann die Zunge verletzt werden. Zudem sollte die Anwendung mit dem Praxisteam abgestimmt werden, damit das biologische Gleichgewicht der Keime im Mund nicht aus dem Lot gerät: Das wiederum hätte zur Folge, dass beispielsweise die Infektionsabwehr gestört werden könnte. Zudem gibt es für Mundgeruch auch andere Ursachen wie Karies, eine Mandelentzündung oder aufsteigende Magensäure. Insofern sollte bei Mundgeruch zuerst eine Zahnarztpraxis aufgesucht werden, um der Ursache auf den richtigen Grund zu gehen. Hier bekommt man auch gezeigt, ob und wie der Einsatz eines Zungenschabers der Mundgesundheit am besten dienen kann.
Zahnverlust in der Postmenopause: Beziehung zu Nierenschäden
Die Teilnehmerzahl an dieser koreanischen Studie, die Zusammenhänge zwischen chronischen Nierenerkrankungen bei postmenopausalen Frauen in Zusammenhang bringt mit der Anzahl der noch vorhandenen Zähne, ist durchaus beeindruckend: rund 75.000 Frauen im Alter zwischen 40 und 79 Jahren. Über acht Jahre wurden entsprechende Daten erhoben und ausgewertet. Dabei waren die Teilnehmerinnen in zwei Gruppen geteilt: Eine Gruppe wies bis zu 20 natürliche Zähne auf, die andere mehr als 20. Grund für die Studie war das bereits vorhandene Wissen, dass nach der Menopause die Nierenfunktion langsam nachlässt, ein spezielles Hormon weniger produziert und der Knochenstoffwechsel dadurch beeinflusst wird. Dieser wiederum kann dazu führen, dass die Zähne an Halt im Kiefer verlieren und verlorengehen. Die große Studie belegte eindrucksvoll, dass postmenopausale Frauen – insbesondere im Alter zwischen 65 und 79 Jahren ¬–¬ mit chronischen Nierenerkrankungen ein um das 40-fache höheres Risiko haben, ihre natürlichen Zähne zu verlieren. In der Konsequenz empfehlen die Wissenschaftler und entsprechenden Fachgesellschaften daher, dass Ärzte mehr auf die Knochengesundheit der Frauen in dieser Altersgruppe achten und eventuellen Mineralverlusten entgegenwirken sollten. Die Nierenerkrankung müsse zudem gestoppt werden, da neben der Belastung der Mundgesundheit auch andere allgemeinmedizinische Folgen auftreten. Auch der sorgsamen altersgerechten Mundhygiene müsse mehr Aufmerksamkeit entgegengebracht werden.
Wikinger: bewusst gefeilte Zähne
Es musste einen Sinn haben, warum sich Wikinger ihre Zähne in Form feilten: Das dachte sich ein deutsches Forscherteam und untersuchte entsprechend die Funde von rund 130 Wikinger-Männern aus dem 11. Jahrhundert, Herkunft vor allem aus Schweden. Auf den Schneidezähnen waren deutlich sichtbar Furchen quer zur Zahnlänge zu sehen. Bisherige Deutungen gingen von der Vorstellung aus, das sei ein Erkennungszeichen für Sklaven, andere Wissenschaftler meinten, die Zahnmarkierung sollte bei Auseinandersetzungen ein angsteinflößendes Gesicht schaffen. Die neuen Studien kamen zu einem anderen Ergebnis, genauer: zu neuen Überlegungen und Einschätzungen. Aktuell geht man davon aus, dass diese – zumal hinter starken Bärten nicht auf den ersten Blick erkennbaren – Markierungen tatsächlich als solche gedacht gewesen sein könnten: So erkannten sich, ähnlich wie heute mit Mitgliedsausweis oder Stempel, Mitglieder einer Gemeinschaft, damals im Bereich von Handelsverbänden. Es sei davon auszugehen, dass diese bewusst angefeilten Zähne nicht dem Schmuck oder der Abschreckung dienten, sondern als Erkennungszeichen „beim Vorzeigen“. Dafür spricht, dass die entsprechenden Überreste der Wikingermänner nicht in Kriegsgebieten, sondern im Bereich wichtiger Handelszentren gefunden wurden.
Studien-Kritik zu Mundspüllösungen: unwissenschaftlich
Auch in manchen Publikumsmedien wurde über eine belgische Studie berichtet, die, kurzgesagt, auf eine angeblich krebserregende Wirkung einer bestimmten Mundspüllösung (Listerine Cool Mint) verwies. Der regelmäßige Gebrauch fördere die Entwicklung von Bakterien, die mit Krebserkrankungen in Verbindung stehen, hieß es da. Das wiesen andere Forscher als „wissenschaftlich nicht haltbar“ zurück: Weder das Studiendesign noch die Interpretation der Ergebnisse untermauerten einen solchen Rückschluss, sowohl Methodik als auch gezogene Schlüsse seien erschreckend eindimensional. Solcherart harsche Kritik ist durchaus selten in der Forscherlandschaft. Ausgangs-Thema der belgischen Studiengruppe war die Frage, ob Mundspüllösungen das Infektionsrisiko homosexuell aktiver Männer mit sexuell übertragbaren Krankheiten minimieren können. Die angebliche krebserregende Wirkung wird dabei mit dem alkoholischen Anteil in der Mundspüllösung in Verbindung gebracht. Nicht erhoben wurde allerdings, auch dies ein Punkt der Studien-Kritiker, ob die ohnehin zu wenigen Probanden möglicherweise im Verlauf der Studiendauer beispielsweise alkoholische Getränke zu sich genommen hatten. Zudem bestätigten die Studienteilnehmer, sich nicht genau an die Anweisungen der belgischen Forscher gehalten zu haben. Auch die Tests selbst wurden nicht hinreichend bezüglich des Vorgehens dokumentiert. Hinzu kommt, dass auch in der Placebo-Gruppe – also bei den Vergleichsteilnehmern, die keine Mundspüllösung nutzten – vergleichbare Veränderungen am Mundschleimhautgewebe festgestellt wurden. Mit der Klarstellung weist der Kreis der Studien-Kritiker darauf hin, dass man nicht vorschnell angeblichen Studien Glauben schenken sollte, die aufgrund reißerischer „Ergebnisse“ durch die Publikumsmedien laufen und Ängste verbreiten oder Wunderergebnisse versprechen: Es mache Sinn, solche Veröffentlichungen beispielsweise in online zugänglichen Fachmedien gegenzuprüfen.
Fehlende Zähne: Adipositas-Risiko
Eine aktuelle Studie an einer US-amerikanischen Universität an rund 1800 Patienten im Alter über 65 Jahre bringt das Forschungs-Ergebnis auf einen einfachen Punkt: Jeder fehlende Zahn fördert Adipositas. Das bedeutet, dass die Anzahl der fehlenden Zähne in Zusammenhang steht mit dem Risiko, eine Fettleibigkeit zu entwickeln – und das Risiko steigt noch, wenn es sich bei den fehlenden Zähnen um Backenzähne handelt. Die Wissenschaftler legen sich sogar auf eine genaue Risiko-Bewertung fest: Jeder Zahn, der zusätzlich zu den schon verloren gegangenen aus der Zahnreihe herausfällt, erhöht das Adipositas-Risiko um zwei Prozent. Fallen zwei gegenüberliegende Backenzähne aus, steigt das Risiko um sieben Prozent. Frontzähne, die eher dem Abbeißen dienen als dem Kauen der Nahrung, spielen beim Adipositas-Effekt eine deutlich kleinere Rolle. Letztlich ist es vor allem der gestörte Kauvorgang, auf den die Gewichtszunahme zurückzuführen ist: Nahrungsmittel, die eher gesund sind wie Obst, Gemüse und feste Körnerbrot-Arten, müssen vor dem Schlucken gut gekaut und mit Speichel angereichert werden. Ist das Kauen kaum noch möglich, ernähren sich die Betroffenen meist durch solche Lebensmittel, die fast nur noch geschluckt werden müssen – überwiegend sind das solche, die auch für Fettleibigkeit verantwortlich sind. Schon eine Änderung der Grundstoffe der Ernährung wäre ein Gesundheitsgewinn, so die Wissenschaftler: Man könne Gesundes auch klein schneiden oder pürieren oder weich kochen und so Alternativen schaffen zu Zucker-, Mehl- und Fett-Produkten. Bisher nicht bekannt war, welche erhebliche Rolle die Backenzähne für die Mund- und damit auch die Allgemeingesundheit spielen: Die Mahlzähne gesund zu erhalten und bei Bedarf frühzeitig zu ersetzen bekommt damit eine neue weitere Gewichtung.