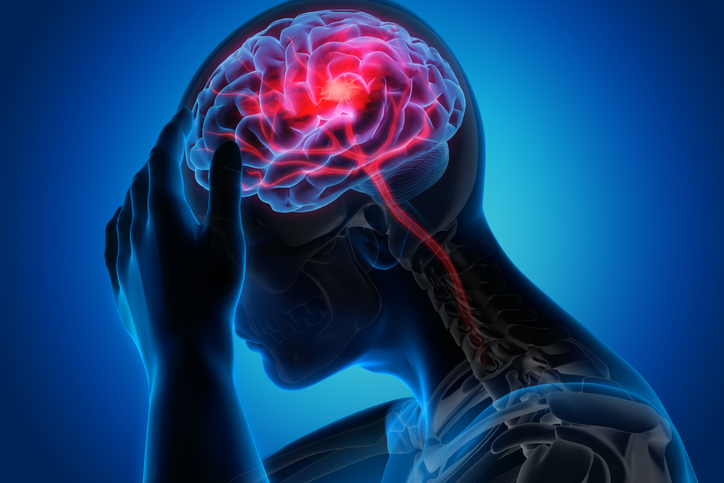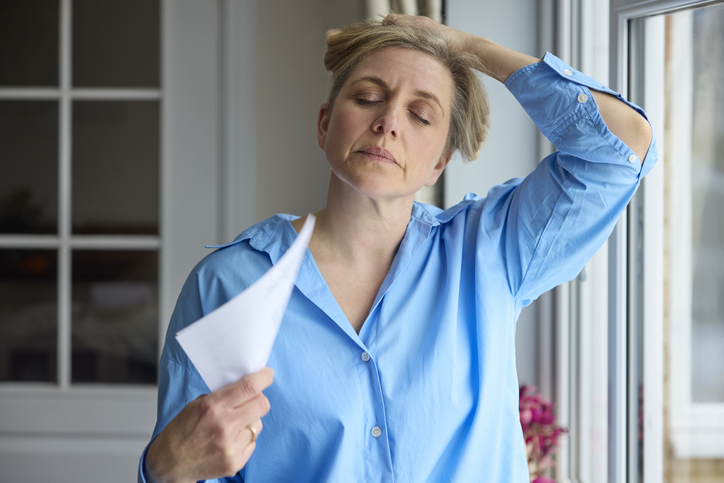Bekanntermaßen kommt es beim Zähneputzen darauf an, dass die Zahnbeläge entfernt werden und man nicht nur über die Zahnflächen hinwegputzt. Weil die Mundgesundheit und letztlich auch die Allgemeingesundheit an erfolgreicher Mundhygiene hängen, werden auch immer wieder Studien gemacht, ob sich das Wissen und Können beim Zähneputzen inzwischen verbessert hat. Auch die Universität Gießen hat solche Daten jüngst wieder erhoben, durch eine Laborstudie an mehr als 1000 Probanden. Die leitende Professorin Dr. Renate Deinzer begann die Vorstellung der Ergebnisse zuerst mit einem großen Kompliment an die Bundesbürger: Es gebe kein vergleichbares Gesundheitsverhalten wie Mundhygiene, das von der Mehrheit der Bevölkerung mit so großer Konsequenz praktiziert werde. Hinsichtlich der Qualität zeigten die Studienergebnisse aber noch Luft nach oben. Es gelinge den meisten Menschen in allen Altersklassen nicht gut, tatsächlich die gesamten Beläge auf und zwischen den Zähnen sowie am Zahnfleischrand zu entfernen. Insbesondere die Plaque am Zahnfleischsaum sei eine wesentliche Ursache für Zahnfleisch- und Zahnbettentzündungen. Videostudien hatten gezeigt, dass beim unstrukturierten „Schrubben“ manchmal ganze Zahnbereiche, zumal die innenliegenden Flächen völlig vergessen wurden. Die Wissenschaftlerin erinnert daran, dass es beim Zähneputzen nicht auf die Dauer und die verwendete Zahnbürste ankomme, sondern letztlich einzig das Ergebnis zähle: Sorgfältige Mundhygiene sei genauso erlernbar wie Schönschreiben in der Schule. Die Zahnarztpraxen seien dafür die richtige Lern-Adresse.
Napoleons Niederlage: Zähne klären auf
Das Jahr 1812 war einschneidend für die Entwicklung der Länder auf unserem Kontinent – und nicht ohne Grund gibt es ein dramatisches Musikwerk gleichen Titels des russischen Komponisten Pjotr Iljitsch Tschaikowsky. Napoleon war mit fast 600.000 Soldaten aus unterschiedlichen Ländern auf dem Weg nach Russland, um das Land zu erobern. Er hat es nur bis Moskau geschafft – aber ohne größere Siege. Zum Jahresende erfolgte der Rückzug, mehr als die Hälfte der napoleonischen Armee überlebte Hunger, Kälte und Krankheiten nicht. Was für Krankheiten waren das eigentlich, die die Soldaten neben den äußeren Umständen das Leben kostete? Eine Biologie-Wissenschaftlergruppe untersuchte das Erbgut aus dem Inneren der Zahnwurzeln geborgener napoleonischer Kämpfer und fand vor allem zwei Erreger, die die Vermutung der damaligen Ärzte untermauerten: eine Salmonellen-Unterart, die für Paratyphus verantwortlich ist, und eine Borrelien-Gruppe, die sogenanntes Rückfallfieber auslöst: Das Fieber kommt und geht, kommt und geht. Für die durch die Umstände und Durchfall bereits geschwächten Soldaten war das tödlich. Die aktuelle Studie an Zahnmaterial hat damit belegt, welche große Rolle Infektionskrankheiten für die damalige Kriegsführung spielten – und wie sie letztlich die politische Weltordnung beeinflusst haben.
Stillen: Ja, aber wie lang?
Stillen ist ein schwieriges Thema in der Bevölkerung, weil es begleitet wird durch viele Mythen und Glaubensrichtungen und durch unterschiedliche Emotionen. Das zeigt aber auch, dass der Bevölkerung das Stillen sehr wichtig ist und sie dieses stark unterstützt. Insofern ist es nicht ganz unheikel, wenn sich die zahnmedizinische Wissenschaft mit klarer Datenlage befasst: Fakten sind in manchen Kreisen kein zu respektierendes Kriterium. Dennoch ist solche Forschung stark zu unterstützen, weil sie eine handfeste Daten-Alternative zu Meinungen bietet. Eine solche Arbeit zum Thema Stillen haben gerade brasilianische Forscher vorgelegt. Hier stand insbesondere die Dauer der Muttermilch-Gabe im Fokus. UNICEF, WHO und viele Wissenschaftliche Einrichtungen empfehlen für das erste halbe Lebensjahr des Kindes Ernährung ausschließlich durch Stillen, danach mindestens 24 Monate einen Mix aus Stillen und zunehmend integrierter altersgerechter Ergänzungsnahrung. Dabei ist zu bedenken, dass diese Empfehlungen für unterentwickelte Länder mit begrenzten Zugangsmöglichkeiten zu Ernährung eine andere Gewichtung haben als für Länder mit einer Vielzahl altersgerechter Nahrungsangebote. Die brasilianischen Forscher wollten vor allem wissen, welche Folgen die lange Muttermilchernährung für die Milchzahngesundheit hat: Muttermilch ist deutlich zuckerhaltiger als Alternativ-Ernährung. Einbezogen in die Studien wurden acht große Datenbanken. Die Ergebnisse raten zu neuen Aufklärungsmaßnahmen und kritischer Haltung gegenüber den Empfehlungen von UNICEF und WHO zumindest für unsere Region: Das Risiko, eine frühkindliche Karies (ECC / Early Childhood Caries) zu entwickeln, so das Studienergebnis, war bei den gestillten Kindern dreimal höher als bei den anderweitig ernährten.
Mundschleimhaut: Leukoplakien-Behandlung
Laut entsprechender Datenerhebungen zeigt jeder vierte Bundesbürger Mundschleimhautveränderungen, die untersucht werden sollten. Erfreulicherweise gingen die meisten Diagnosen für die Patienten positiv aus, so eine Mainzer Studie, dennoch bleiben solche Veränderungen im Blick, da manche nach Jahren doch noch eine ungesunde Entwicklung machen. Auch aktuell harmlose Stellen in Mund können in Richtung Mundschleimhautkrebs entarten. Insbesondere Veränderungen, die als „Lichen planus“ bekannt sind oder als „Leukoplakien“ sollten regelmäßig nachkontrolliert werden. Leukoplakien (nicht abwischbare, in der Regel schmerzfreie weiße Stellen auf der Haut) haben dabei weltweit das häufigste Potential zu einer malignen Veränderung, also der ungesunden Vermehrung bösartiger Zellen. Je nach Entwicklung reicht bei leichten Fällen eine regelmäßige Kontrolle und das Weglassen schädlichen Verhaltens, hier insbesondere das Rauchen. Es ist nicht selten, dass sich die Hautschäden zurückbilden. In anderen Fällen kann eine komplette Entnahme des belasteten Gewebes notwendig sein. Ist eine Krebserkrankung bestätigt, sollte die Behandlung, so die Wissenschaftler, am besten interdisziplinär in Verbindung mit einem onkologischen Zentrum erfolgen.
Zahnärzteschaft: Politik bestätigt Präventionserfolge
Dass die Präventionsbemühungen der deutschen Zahnärzteschaft nicht nur sehr erfolgreich sind, sondern dieser Erfolg auch gesehen und gewürdigt wird, zeigte die zurückliegende Bundesversammlung der Bundeszahnärztekammer. Zu dieser Veranstaltung kam Bundesgesundheitsministerin Nina Warken persönlich. Sie betonte, Zahnärztinnen und Zahnärzte deckten einen unverzichtbaren Teil der Gesundheitsversorgung ab. Dafür wolle sie sich bedanken. Von der zahnärztlichen Versorgung ließe sich einiges lernen: Die Ausgaben dafür seien in den zurückliegenden Jahren kaum gestiegen, während sich die Zahngesundheit deutlich verbessert habe. Die gute Entwicklung sei, so die Ministerin, das Ergebnis des zahnärztlichen Engagements und der klaren Ausrichtung auf Prävention und habe Vorbildfunktion. Lobenswert fand die Gesundheitsministerin auch den ganzheitlichen Blick der Zahnärzteschaft auf die Gesundheit sowie auf die Wirtschaftlichkeit von Maßnahmen. Elektronische Verfahren in der Verwaltung bezeichnete sie als „echte Leuchtturmprojekte in der Versorgung.“ Das Ministerium begleite die Entwicklung auf vielfachen Themen-Ebenen, darunter die Versorgung in den ländlichen Regionen sowie den Punkt Fachkräftemangel. In seinem Dank für das lobende Grußwort sagte Prof. Dr. Christoph Benz, Präsident der Bundeszahnärztekammer, die Ministerin habe mit ihrem Hinweis auf den notwendigen Bürokratieabbau die Zahnärzteschaft voll hinter sich und betonte, Deutschland sei „Weltmeister in der Mundgesundheit.“
Knirschen: nicht gut für Implantate
Auch wenn man sich das selbst mit laienhaftem Wissen gut vorstellen kann, ist es doch gut für Wissenschaft und Praxis, wenn eine Studie das auch untermauert: Knirschen erweist sich als Risiko über das Langzeitüberleben von Zahnimplantaten. Wie ein Beitrag in einer großen Fachzeitschrift darstellt, führen solche nicht natürlichen Belastungen wie Knirschen oder Zähnepressen zu Problemen in der Mechanik des Implantates mit seinem Zahnkronenaufbau. Die Folgen dieser Fehlbelastung sind vielfältig und reichen bis hin zu Brüchen von Zähnen und Implantaten. Ein großes Gewicht legten die Wissenschaftler daher auf den Punkt, wie man solche Stress-Belastungen vermeiden kann. Begrenzte Erfolge hatten demnach Physiotherapie, spezielle Schienen und auch individuelle Patientenberatung. Was sich dabei kaum veränderte, war die kraftvolle Arbeit der Muskulatur. Daher konzentrierte sich die Arbeit der Forscher auf Möglichkeiten, die Muskulatur zu entspannen. Hierbei erwies sich „Botox“ (Botulinumtoxin Typ A) als sehr hilfreich für eine zeitweilige Muskelentspannung. Der Effekt: Die überaktive Muskulatur entwickelte sich zurück, die Schmerzen und der Kaudruck waren ebenso reduziert wie der Abbau der Kieferknochen um das Implantat und die Anzahl der Implantatverluste. Noch fehlen dazu weitere Tests und auch Vorgaben zum standardisierten Vorgehen. Dennoch deutet sich an, dass das seit Ende des 20. Jahrhunderts genutzte Arbeiten mit Botulinumtoxin bei Knirschen und Pressen, aber auch bei Migräne erfolgsversprechend ist und hinsichtlich einer Vermeidung von Misserfolgen bei Zahnimplantaten in Langzeitstudien weiter geprüft werden sollte.
Fluorid: gut für IQ-Entwicklung
Eine ebenso steile wie unbewiesene Meinung, als Fachwissen deklariert, geistert schon längere Zeit durch die „sozialen Medien“ und durch entsprechend empfängliche Elternkreise: Fluorid mache dumm, lautet diese Meinung. Vielleicht kann die aktuelle Langzeitstudie einer US-Wissenschaftlergruppe hier etwas Bewegung in die Debatte bringen? Anlass war die Frage, ob Trinkwasser fluoridiert werden solle oder nicht. Unabhängig von der Frage, wie man grundsätzlich zu einer „Behandlung“ von Trinkwasser steht, geht es darum, dass der natürliche Fluoridgehalt im Trinkwasser in den verschiedenen Regionen der USA und der Welt sehr unterschiedlich ausgeprägt ist. Und dass andere Studien zeigen, dass Kinder und Erwachsene in Regionen mit eher etwas höherem Anteil an natürlichem Fluorid die mit Abstand gesünderen Zähne haben. Was die Wissenschaftlergruppe von den bisherigen „Studien“ zum Thema hält, hat sie mit „nicht repräsentativ, nicht vergleichbar, nicht relevant“ ziemlich klar gemacht –zumal die untersuchten Kinder-Gruppen in eher sehr armen, ländlichen Bevölkerungsgruppen in Mexiko, China oder Indien lebten. Die aktuelle Studie basiert auf Daten von über 58.000 US-Jugendlichen aus 1980, über 25.000 wurden in den Folgejahren mehrfach befragt, die meisten Teilnehmer waren im Abschlussbefragungsjahr 2020 schon über 60 Jahre alt. Das Ergebnis in Kurzform: Junge Menschen, die mit empfohlenen Fluorid-Mengen im Trinkwasser groß wurden, hatten deutlich bessere kognitive Fähigkeiten im Wortschatz- und Lese-Vermögen sowie in mathematischen Fähigkeiten. Bilanz der Forscher: „Die Ergebnisse zeigen, dass die Trinkwasserfluoridierung Vorteile für die kognitive Entwicklung von Jugendlichen hat und schlimmstenfalls nicht schädlich fürs weitere Leben ist.“
Zucker: Verzicht für gesundes Altersherz
Nicht nur die Zahn- und Mundgesundheit profitiert lebenslang, wenn schon seit der frühen Kindheit der Zuckerkonsum deutlich reduziert wird: Offenbar schützt dieses Verhalten auch das Herz. So wie sich die Mundgesundheit mit den Lebensjahren auf der Grundlage dessen weiterentwickelt, was ihr aus den Kinderjahren mit auf den Weg gegeben wurde, geht auch die Herzgesundheit mit den Jahren in eine gesunde oder ungesunde Richtung. Chinesische Wissenschaftler haben kürzlich fast 64.000 Daten der britischen „Biobank“ zu der Fragestellung verglichen, welche Rolle reduzierter Zuckerkonsum auf die Entwicklung der Herzgesundheit im höheren Alter spielt. Das Durchschnittsalter der an der Studie beteiligten Probanden lag bei 55 Jahren. Es zeigte sich: Die Älteren, die in ihrer Kindheit nur wenig Zucker bekamen, hatten ein um 20 Prozent geringeres Risiko für spätere Herz-Kreislauf-Erkrankungen, um 25 Prozent niedriger lag das Risiko für einen Herzinfarkt, auch für tödliche Infarkte, ebenso das Risiko für Herzrhythmusstörungen und Herzinsuffizienz. Sogar um 31 % lag das Schlaganfallrisiko bei „Zuckerarmen“ niedriger als bei der Vergleichsgruppe. Hauptgründe dafür sind bessere Blutzucker- und Blutdruckwerte. Und noch etwas zeigte sich: Je länger man den Zuckerverbrauch reduzierte, desto besser war das Ergebnis. Das eindeutig erscheinende Ergebnis solle nun quer getestet werden mit Blick auf Genetik und Lebensstilfaktoren, um solche Effekte in ihrer Relevanz mit einzubeziehen. Auch die Einbeziehung der Ergebnisse mit Blick auf die Mundgesundheitsentwicklung wären interessant.
Hirnerkrankungen: Ist Parodontitis beteiligt?
Zu den Körperbereichen, deren krankhafte Entwicklung mit Parodontitis in Verbindung stehen könnten, gehört auch das Gehirn. Anhand von Daten einer Langzeit-Studie mit fast 16.000 Teilnehmern aus verschiedenen Gebieten in den USA hat eine interdisziplinäre US-Wissenschaftlergruppe nach entsprechenden Zusammenhängen geforscht. Ihre Fragestellung: Kann die Behandlung einer bestehenden Zahnbettinfektion die Entwicklung von Erkrankungen im Gehirn verhindern? Im Vergleich von Patienten mit und ohne Parodontitis zeigten diejenigen mit Zahnbettinfektion deutlich mehr Anzeichen für Entzündungen, Durchblutungsstörungen und Abbauprozesse von Gehirnbereichen. Und obwohl die Parodontitis keine direkte Rolle bei Erkrankungen der kleinen Hirngefäße (zerebrale Mikroangiopathie) spielt, ist es doch ihr systemischer Effekt: Im Fall einer Zahnbettentzündungen gelangen Entzündungskeime über die Blutbahn in den gesamten Körper – und auch durch die Bluthirnschranke in das Gehirn. Wenn die kleinen Blutgefäße im Gehirn infiziert werden, entwickelt sich eine Verdickung, Verengung und Verhärtung der Gefäßwände, dadurch kann sich eine Demenz entwickeln. Eine Wiederherstellung der Mundgesundheit durch eine Parodontitis-Therapie sorgt daher auch für eine Vorbeugung von Gehirn-Gefäßerkrankungen.
Wechseljahre: Effekte im Mund
Kürzlich hat ein Fachjournal rund um das Thema „Gesundheit in der Lebensmitte“ eine Vielzahl an Studien zu Menopause und Mundgesundheit ausgewertet und eine Ergebnisbilanz gezogen. Dabei zeigte sich, kurz gesagt, ein sehr deutlicher Zusammenhang von Knochenabbau im Kiefer, Parodontitis und beispielsweise Mundtrockenheit mit den Veränderungen im Hormonstatus der untersuchten Frauen. Während es eine Vielzahl an wissenschaftlichen Arbeiten zu Schlafstörungen, Hitzewallungen und anderen typischen Menopausen-Zuständen gibt, waren Untersuchungen zur Mundgesundheit eher rar. Die Ergebnisse zeigen, dass das Thema eine größere Aufmerksamkeit benötigt. Der Rückgang bestimmter Hormone im weiblichen Wechseljahre-Körper hat deutliche Folgen für die Schleimhäute, für die Zähne, für das Zahnbett und den Kieferknochen. Die Widerstandskraft gegen Infektionen wie Parodontitis sinkt durch eine geänderte Immunabwehr, das Zahnfleisch blutet leichter, das Zahnbett bildet sich vielleicht spürbar zurück und es droht Zahnverlust, auch weil durch den sinkenden Östrogenspiegel der Kieferknochen abgebaut wird. Eine frühere Studie an der Universität Greifswald hatte zudem gezeigt, dass Frauen, die den Hormonmangel nicht durch entsprechende Medikamente ausgleichen, deutlich mehr Zahnverlust hatten als die Vergleichsgruppe mit Hormonersatztherapie. Die Wissenschaftler begrüßen Angebote in der Zahnarztpraxis, die Frauen speziell in und nach den Wechseljahren begleiten und die Zahn- und Mundgesundheit erhalten helfen.